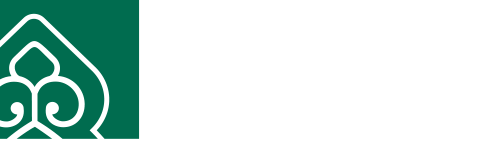Herzlich willkommen!
Nachdem die Stiftung Heiligenberg Jugenheim das Schloss Heiligenberg mit seiner imposanten Parklandschaft von der Hessischen Lehrerfortbildung übernommen hatte, entwickelte sich das Kleinod an der Bergstraße zu einem Publikumsmagneten. Viele Besucher wissen es zu schätzen, historische Informationen in wunderschönem Ambienten mit Spaziergängen in herrlicher Natur zu verbinden. Und auch die zunehmende Zahl an privaten Feierlichkeiten sowie an Seminaren und Tagungen unterstreicht die Beliebtheit des Schlosses Heiligenberg.
Die Geschichte des Heiligenbergs
Auf dem Heiligenberg befand sich in fränkischer Zeit ein als Gerichts- und Versammlungsort genutzter Platz. Einmal jährlich fand das Zentgericht statt. Daran erinnert die etwa 800 Jahre alte Zentlinde im Kreuzgarten.
Nach der Säkularisation (1803) fiel der Heiligenberg an Hessen-Darmstadt. Großherzog Ludwig I. von Hessen schenkte den Heiligenberg 1810 an August Konrad von Hofmann – ein verdienter Beamter, der die Finanzen des Landes geordnet hatte. Dieser ließ zwischen 1814 und 1816 neue Gutsgebäude mit Wohnhaus, Schuppen, Ställen, Keller, Waschküche und mit einer Schnapsbrennerei aufbauen. Er legte außerdem Obstgärten und Weinberge an. Zur Wasserversorgung wurde eine zwei Kilometer lange Brunnenleitung vom Tannenberg gelegt.
1827 erwarb die badische Prinzessin Wilhelmine, Gemahlin des späteren Großherzogs Ludwig II., das Gut und ließ es 1831 nach Plänen des hessischen Oberbaudirektors Moller zu ihrem Sommerwohnsitz ausbauen. Im Hauptgeschoss entstand ein herrschaftliches Schlafzimmer mit Kamin und Ofen. Zur Rheinseite hin gab es einen Balkon mit Überdachung. Mit seinen nunmehr neun Schlafzimmern, dem Weinkeller, zehn Pferdeställen und Schweineställen ist aus dem Landgut ein fürstlicher Sommersitz geworden.
Da auf dem Heiligenberg mindestens drei Monate im Jahr Hof gehalten wurde, haben auch die Bäcker, Metzger, Wirte und Handwerker in Jugenheim ihr Auskommen. Wilhelmine hat außerdem ein großes Herz für Arme, Alte und Kranke. In der Chronik der Jugenheimer Bergkirche ist erwähnt, dass es zu dieser Zeit keine wirklich armen Leute in Jugenheim gegeben hat.
Doch mit nur 48 Jahren starb Großherzogin Wilhelmine am 27. Januar 1836. Sie hinterließ das Anwesen ihren jüngsten Kindern Marie und Alexander. Prinz Alexander heiratete Julie von Hauke. Die Familie erhielt den Namen Battenberg und so wurde Schloss Heiligenberg zum Stammsitz der Familie Battenberg/Mountbatten. Im 19. Jahrhundert trafen sich hier die russischen, englischen und hessischen Dynastien.
Bis 1910 suchten die Zaren Alexander II., Alexander III. und Nikolai II. Schloss Heiligenberg zur Sommerfrische auf. Ihr Weltreich wurde in dieser Zeit von Jugenheim aus regiert, hier fanden europäische Politik und Diplomatie statt.
Nach dem 1. Weltkrieg verkaufte Ludwig, Prinz von Battenberg, ältester Sohn von Prinz Alexander, das Schloss. Über einige Umwege gelangte es schließlich an das Land Hessen.
Die prominentesten Nachkommen der Battenberger sind heute Prinz Charles, Prince of Wales, Sohn von Königin Elisabeth II. von Großbritannien, und Felipe VI., König von Spanien.
Die Parkanlage von Schloss Heiligenberg
Die gärtnerische Geschichte des Heiligenbergs beginnt vermutlich schon mit dem Kloster, das hier vom 13. bis 15. Jahrhunderts bestand. Wahrscheinlich gab es landwirtschaftliche Einrichtungen zur Versorgung der Nonnen, zum Beispiel Acker- und Weinbau, Obstgärten, Kastanien- und Nussbäume. Diese Art der Bewirtschaftung ist auch aus späterer Zeit bekannt. Besonders der Jugenheimer Pfarrer Christian Friedrich Lindenmeyer hat von 1771 bis 1788 Terrassierungen der Hänge vorgenommen, pflanzte Kirsch- und Nussbäume.
Ab 1789 wurde der im Besitz des Klosters Lorsch befindliche Heiligenberg von den Herren von Hausen als Verwalter des Klosters Lorsch bewirtschaftet. Im Jahr 1803 fiel der Berg an Hessen und gelangte 1810 in den Besitz des großherzoglich darmstädtischen Hofkammerrats und späteren Finanzministers August Konrad Hofmann (1776 – 1841). Er ließ die Gebäude weiter ausbauen. Zwei Ziergärten waren zu seiner Zeit vorhanden: Ein in drei Terrassen gegliederter regelmäßiger Garten am Westhang vor dem Haupthaus des Landguts – dort, wo sich heute auch noch der Terrassengarten befindet – und eine kleine landschaftliche Partie um die Kapellenruine und die Zentlinde.
1827 verkaufte Hofmann das Landgut mit den umliegenden Ländereien an Erbgroßherzogin Wilhelmine (1788 – 1836). Sie erwarb das Landgut wohl als eine Art Rückzugsort vom Darmstädter Hof und auch als Sommersitz. Sie ließ bedeutende Verschönerungen vornehmen, die zum großen Teil heute noch Schloss und Schlosspark Heiligenberg prägen. So ließ sie um 1829 die beeindruckende Linden-Terrasse mit Balustrade anlegen und dort einen offenen Pavillon mit großer Zwiebelhaube errichten (Pavillon wohl im Zweiten Weltkrieg niedergelegt). Auch der ursprünglich fast bis zur Kapellenruine reichende, etwas 200 Meter lange Laubengang wurde in ihrer Zeit gepflanzt.
An der Parkgestaltung war der badische Hofgartendirektor Johann Michael Zeyher (1770 – 1843) aus Schwetzingen beteiligt. Leider gibt es keinen Plan oder Briefe aus seiner Hand zum Park Heiligenberg. Wilhelmine war eine geborene Prinzessin von Baden und griff auch bei der Gestaltung des Parks Rosenhöhe, bei Umgestaltungen im Palaisgarten und dem Herrengarten in Darmstadt sowie dem Park von Jagdschloss Wolfsgarten auf Zeyher zurück. Mit dem Ausbau des Gebäudebestands war Baurat Georg Moller (1784 – 1852) betraut.
Wilhelmine starb schon 1836 mit 48 Jahren. Sie vermachte ihr nun verschönertes Landgut ihren beiden jüngsten Kindern Alexander (1822 – 1888) und Marie (1824 – 1880). Als Marie sich im Alter von 17 Jahren mit dem russischen Thronfolger Alexander, dem späteren Zar Alexander II., vermählte, fiel das Landgut an ihren Bruder Alexander. Doch sie blieb dem Heiligenberg zeitlebens verbunden und besuchte häufig ihren Bruder im Sommer mit ihrer Familie und dem umfangreichen Gefolge des Zaren.
Unter Alexander und seiner Ehefrau Julie erhielt der Park des Schlosses Heiligenberg seine bis heute überlieferte Gestalt. Unter Leitung des gut ausgebildeten Hofgärtners Johannes Gernet (1831 – 1903), der von 1851/52 bis zu seinem Tod auf dem Heiligenberg wirkte, entstanden noch weitere Parkteile. Hier fallen besonders Pflanzungen mit damals wertvollen und seltenen Nadelgehölzen auf, von denen heute noch alte Weihrauch-Zedern, Kaukasische Fichten, beeindruckende Mammutbäume, Spanische Tanne und Kolorado-Tanne zeugen. In dieser Zeit wurden auch weiter vom Schloss entfernt liegende Parkteile zwischen dem Stettbacher und Balkhäuser Tal durch Wege, Plätze und Baumpflanzungen verschönert. Gernet leitete auch die umfangreichen Küchen- und Obstgärten, mit deren Erzeugnissen die Besitzerfamilie und ihre hohen Gäste versorgt wurden. 1865/66 errichteten die Kinder zur Erinnerung an ihre Mutter, Großherzogin Wilhelmine, das Goldene Kreuz in der Nähe der Zentlinde. Nach dem Tod von Alexander von Hessen und bei Rhein, 1888, wurde dieser Platz mit einem schönen Ziergitter eingefriedet, 1892-94 eine Gedächtniskapelle und 1902 eine Grabstätte eingerichtet.
Um 1877 wurde der obere Teil der Schlosszufahrt verändert und dafür ein Fahrdamm angelegt. Im Zuge des Aushubs legte Gernet den gebuchteten Weiher an, dessen Umfeld ebenfalls mit wertvollen Koniferen bepflanzt ist. Unter Alexander wurde das Schlossgeviert sukzessive ausgebaut und vor allem Remisen, Ställe und Ökonomiebauten nach außen an das südliche Ende des Küchengartens verlagert.
Schloss und Park Heiligenberg erbte der älteste Sohn von Alexander und Julie, Ludwig (1854 – 1921). Ludwig, der schon als Jugendlicher in die Britische Marine eintrat und dort Karriere machte, nutzte nach seiner Heirat 1884 mit Viktoria von Hessen-Darmstadt (1863 – 1950) den Heiligenberg regelmäßig zum Sommeraufenthalt. Um 1904 ließ das Paar einige Umbauten an Schloss und Park vornehmen. Insbesondere wurde die oberste Terrasse am Schloss vergrößert und mit einer Stützmauer versehen, und der Terrassengarten erhielt die Gestalt eines Rosengartens mit abschließender Pergola.
1920 verkaufte Ludwig, nun 1st Marquess of Milford Haven, den Heiligenberg. Etwa zehn Jahre blieb das Anwesen in privater Hand, wobei der Park eher vernachlässigt wurde, dann erwarb der damalige Volksstaat Hessen Schloss und Park, um nach 1933 eine Obergauführerinnenschule einzurichten. Der Park wurde in dieser Zeit im Wesentlichen vom Forstamt Jugenheim gepflegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog das Pädagogische Institut ein, das die Zier- und Nutzgärten mit eigenen Gärtnern unterhielt. Lediglich das Erdgewächshaus musste 1957 einer Turnhalle weichen. In den 1960er Jahren wurde der Küchengarten sukzessive zu einer Obstwiese umgestaltet. Die Wirtschaftsgebäude und die Turnhalle riss man in den 1980er Jahren ab. Rosengarten und Laubengang wurden in dieser Zeit erneuert.
Autorin: Barbara Vogt, Büro „Der alte Garten“, Frankfurt am Main (2014)