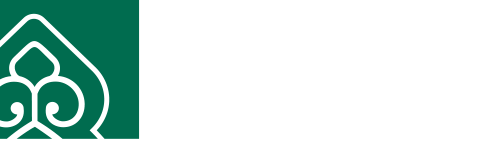Alle Veranstaltungen, die im Jahr 2023 stattgefunden haben
Quo vadis? Die EU in der Zeitenwende – zwischen nationalen Interessen und gemeinsamer Positionierung und Entwicklung
Prof. Dr. Kiran Klaus Patel, Ludwig-Maximilians-Universität München, Lehrstuhl für
Europäische Geschichte, Direktor Project House Europe
Donnerstag, den 26. Oktober 2023, 19.00 Uhr
Schloss Heiligenberg – Gartensalon
Auf dem Heiligenberg 8, 64342 Seeheim-Jugenheim

Der russische Angriff auf die Ukraine, wachsende geopolitische Spannungen wegen China, die Folgen der Pandemie sowie der drohende Klimawandel stellen die EU und ihre Mitgliedsstaaten vor besondere Herausforderungen.
Das Völkerrecht als Basis internationalen Interessenausgleichs, die auf Globalisierung ausgerichtete Wirtschaft und die auf Abrüstung zielende Sicherheitspolitik werden massiv in Frage gestellt. Bislang respektierte Internationale Institutionen, Verfahrensweisen und Verträge verlieren an Bedeutung und drohen zu scheitern.
Diese neuen Realitäten werfen für die EU gigantische Fragen auf: Wie kann sie sich in den globalen Auseinandersetzungen einheitlich positionieren, wie sich in der Sicherheits-, Wirtschafts- und Klimapolitik sowie in der Beitrittsfrage weiterer Staaten neu ausrichten?
Die Auseinandersetzungen über die Entwicklung der EU in der Vergangenheit und die sich abzeichnenden unterschiedlichen Positionen der Mitgliedstaaten deuten auf einen schwierigen Weg hin.
Professor Dr. Patel erläutert die Tragweite der Zeitenwende für Europa und die Perspektiven der Europäischen Union. Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen und Entwicklungen der Vergangenheit gibt er eine Einschätzung der Neuausrichtung, Neuaufstellung und der Handlungsfähigkeit der EU.
Kann die EU angesichts divergierender nationaler Interessen unter den Mitgliedstaaten die sicherheits-, wirtschafts- und klimapolitischen Herausforderungen gemeinsam angehen?
Wie sollte die EU sich in den internationalen Beziehungen positionieren? Kann sie in den geopolitischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und China, in ihrer Haltung zu Russland und in ihrer Stellung in der Welt zu einer einheitlichen Positionierung kommen?
Wie handlungsfähig ist sie mit Blick auf die bisherigen Institutionen, Verfahren und Mechanismen zur Entscheidungsfindung?
Werden die Karten innerhalb der EU neu gemischt? Verschiebt sich das Gravitationszentrum nach Osten? Welche Auswirkungen hätte eine EU-Erweiterung durch die Ukraine, Moldawien und die Balkanstaaten?
Quo vadis EU – Wirtschaftsraum oder politische Union?
Mitschnitt der Veranstaltung:
Pressetext:
Prof. Dr. Kiran Klaus Patel im Forum Heiligenberg:
In ihren Krisen gewann die EU an Statur und Kompetenz
Seeheim-Jugenheim. 26. Oktober 2023. Den kritischen Gästen des Forums Heiligenberg mutete es paradox an: Der europäische Einigungsprozess hat sich in den Köpfen der Bürger mehrheitlich als eine Abfolge heftiger Kontroversen, gescheiterter Marathonsitzungen, Kuhhandel und mühselig ausgehandelter Kompromisse eingenistet. Doch in Wirklichkeit hat sich seit Beginn des europäischen Einigungsprozesses ab 1950 mit Montanunion, Euratom, EWG und schließlich der EU das Gebilde Europa trotz vieler Negativnachrichten zu einem bedeutenden Staatenverbund von 27 Ländern und 450 Millionen Menschen entwickelt. Auf dem Weg dorthin war die EU nicht der Verlierer, sondern der Gewinner von Statur und Kompetenz. Die EU kann Krisen lösen.
Weshalb Professor Dr. Kiran Klaus Patel, Lehrstuhlinhaber für Europäische Geschichte an der Münchner Maximilians-Universität, der Europäischen Union als Referent des Forums Heiligenberg durchaus eine dauerhafte Zukunft prognostiziert. „Weitere Beitrittskandidaten stehen vor der Tür, es wird immer heftige Kontroversen geben und in zehn Jahren wird die EU nicht viel anders sein als heute. Sie wird Stückwerk bleiben und es wird auch keine neuen Debatten über eine neue Struktur und neue grundlegende Verträge geben.“ Im Laufe ihrer Geschichte habe die EU auf vielen Feldern unglaubliche Kompetenzen gewonnen. „Die EU ist ein Laboratorium, und das nicht erst seit gestern,“ antwortete Patel auf die Zukunftsfrage des Moderators Stefan Schröder vom Wiesbadener Presseclub.
Schröder steuerte geschickt die Fragen aus dem Publikum, was Patel ermöglichte, seinen Befund weiter zu konkretisieren: Sollte man etwa nicht ein „Europa der zwei Geschwindigkeiten“ verfolgen, in dem die Progressiven voranschreiten und die Kleineren, Zögerlichen irgendwann dann folgen? Patel: „Das haben wir doch längst.“ Und er verwies auf die unterschiedlichsten Konstellationen in unserem unierten Europa: Einige Länder haben den Euro als Gemeinschaftswährung akzeptiert, andere nicht; einige Staaten sind Mitglied der Schengen-Gruppe, andere nicht; die Fragen von Asyl und Migration werden in Polen und Ungarn anders gesehen als in Irland oder Spanien, die sich wiederum von den anderen europäischen Industriestaaten in ihren politischen Ansätzen unterscheiden. Die Mitgliedsstaaten hätten eine erstaunliche Fähigkeit entwickelt, gerade bei den gegenwärtigen Themen Migration, Asylrecht, Ukrainefrage, Terroranschläge gegen Israel „Brandmauern zwischen den Krisen zu errichten.“ Im gewissen Sinn gibt es wechselnde Koalitionen bei den individuellen Krisen. „Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten lässt sich nicht etablieren, weil dies extrem problematisch wäre. Die Politik sollte sagen: Ja, wir sind dauerhaft differenziert.“ Es werde deshalb beim dauerhaften „Durchwurschteln“ bleiben. „Das ist nicht schön. Aber wie bei alten Kirchengebäuden mit gotischer Fassade, barocken Altären und neuzeitlichen Einbauten ist manch anderes auch nicht schön. Aber sie erfüllen ihre Aufgabe.“
Das Interessante an der Entwicklung Europas sei, dass als Impulsgeber für Fortschritte eher das Erkennen ökonomischer und technischer Notwendigkeiten z.B. durch die Wirtschaft ausschlaggebend gewesen seien, als politische Vorgaben. Ein „Europa, das schützt“ müsse doch jetzt „bei Verteidigungsfragen mehr Gas geben“, wandte Stefan Schröder ein: Patel stimmte ihm zu, die Frage der Sicherheit sei dringend. „Wir müssen nachdenken, was die EU ohne die USA macht?“ sollte das Engagement einmal nachlassen. Die Union besteht aus Nationalstaaten, eine gemeinsame Armee sei unrealistisch, so Patel, aber bei Fragen der Beschaffung sei ein Zusammenrücken sinnvoll.
Wichtig für die Bürger Europas, aber auch die Verantwortlichen in den Institutionen, sei es zu lernen, „mit Komplexität umzugehen und Komplexität auch auszuhalten.“
Der Vorsitzende des Forums Heiligenberg, Gerd Zboril, zog einen positiven Schlussstrich unter die hochaktuellen Themen, die das Forum in diesem Jahr diskutiert hat. Die Nachfrage der interessierten Bürger sei in der Regel größer als das Angebot von Sitzplätzen im Gartensaal des Schlosses. Das Forum-Team arbeitet derzeit am Programm für 2024, dessen Inhalt stark vom Gang der Krisen beeinflusst werden dürfte. WV
Nie wieder Frieden?
Deeskalation und Frieden in Europa
Dr. Jonas J. Driedger, Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung
Donnerstag, den 4. Mai 2023, 19.00 Uhr
Schloss Heiligenberg – Gartensalon
Auf dem Heiligenberg 8, 64342 Seeheim-Jugenheim

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit dem unermesslichen Leid der Bevölkerung, der Zerstörung von Infrastruktur und den weltweiten Auswirkungen stellt mit Vehemenz und Dringlichkeit die Frage nach Deeskalation und Frieden.
Offensichtlich geht es um einen grundsätzlichen Systemkonflikt, in dem Völkerrecht und Prinzipien der UN-Charta verletzt, bisherige friedenssichernde Vereinbarungen, Institutionen und Verfahren außer Kraft gesetzt, demontiert und unwirksam werden. Eine auf Ausgleich der Interessen und Abrüstung zielende Politik ist fundamental in Frage gestellt.
Trotz der brutalen Realität, der militärischen Situation im zweiten Kriegsjahr und der bedrohlichen Gefahr einer unkontrollierbaren Eskalation ist keine Bereitschaft zu Erfolg versprechenden, friedensstiftenden Verhandlungen zu erkennen. Mit Vehemenz stellt sich die Frage nach Wegen und Möglichkeiten zur Deeskalation und nachhaltiger Friedenssicherung.
Dr. Jonas J. Driedger vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung geht der Frage nach: Unter welchen Bedingungen und Formaten kann angesichts der ukrainischen und russischen Regime- und Kriegsdynamik, der Strategie des Westens und der Positionierung internationaler Akteure deeskaliert und ein gerechter Frieden nachhaltig gesichert werden?
Einschätzung der militärischen, humanitären, politischen und wirtschaftlichen Lage
- Strategie des Westens: Aggression darf sich nicht lohnen! Durchsetzung und Sicherung des Völkerrechts, Sanktionen und militärische Unterstützung der Ukraine
- Strategie Putin-Russlands: Kriegsziele und Kriegsführung, Kriegsauswirkungen in Russland unter Betrachtung der Rolle und Interessen Chinas, Indiens, der Türkei und des globalen Südens
- Deeskalation und Friedenssicherung: Militärische Eskalation, Ausweitung des Kriegs vs. Diplomatie: Erfolg versprechende Strategien und Schritte einer Deeskalation, Bedingungen und Voraussetzungen von Verhandlungen, mögliche Vermittler
- Perspektiven einer neuen Friedensordnung: Sicherheitsgarantien und Aufbau einer neuen Friedensordnung in Europa
Moderation:
Prof. Dr. Bernd Steffensen, Hochschule Darmstadt
Mitschnitt der Veranstaltung:
Pressetext:
Friedensforscher Dr. Jonas Driedger sieht russischen Angriffskrieg bis zur Erschöpfung weitergehen
Seeheim-Jugenheim. 4. Mai 2023. Ob es im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine jemals wieder Frieden gibt? „Der Abend lässt uns schwermütig zurück“, fasste Gerd Zboril als Vorsitzender des Forums Heiligenberg Jugenheim die Erörterung dieser Themenfrage zusammen.
Die Lage ist vertrackt Als Experte eingeladen war Dr. Jonas Driedger vom Leibnitz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Mit medizinischen Begriffen sezierte er die Ursachen des Krieges und prüfte, ob und welche Heilmittel es zur Deeskalation und nachhaltigen Sicherung eines Friedens gibt. Seine Diagnose: Wir erleben einen Abnutzungskrieg, der noch lange dauern und bestenfalls zunächst nur zu einem „negativen Frieden“ führen dürfte.
Wünschenswert – aber fern – sei ein „positiver Frieden“, dessen Grundlage die Herstellung einer Vertrauensbasis ist. Negativ sei ein Frieden zu bezeichnen, dessen Kriterium lediglich die Abwesenheit von Gewalt ist. Etwa der Kalte Krieg bis zur Wende. Positiv ist ein Friede, „wenn beide Seiten, unterstützt durch ein Narrativ der Gemeinsamkeit, sich sagen können: Der andere schießt nicht auf mich“. Wie lange es dauert, solch einen Zustand zu erreichen, habe die historische Entwicklung nach 1945 gezeigt. Das Vertrauen ist jedoch durch den Bruch des Völkerrechts durch Russland abhandengekommen. „Kriege um Territorien sind immer besonders blutig“, so Jonas Driedger.
Während Russland mit despotischen Mitteln die Geschichte zurückdreht, den Erhalt seines Systems zur Maxime erhebt und dazu noch eine etwa mit der Krim gewaltsam wiedergewonnene „russische Welt“ als heilig betrachtet, hat dieser Staat innen- wie außenpolitisch eine Position aufgebaut, die jedem, der diesem Dogma nicht folgt, mit „Furcht einflößenden Szenarien“ droht, frei nach dem Motto: „Man kann einer russischen Diplomatie keine Angst machen.“ Putin gehe es um den Erhalt seiner persönlichen Macht; zudem herrsche in Russland eine „genuine Paranoia“ gegen die NATO, dass das Verteidigungsbündnis Russland zerstören wolle.
Dem allem ausgeliefert ist die Ukraine, „eine demokratische Entität“, die – ähnlich Westdeutschland im Kalten Krieg mit seinem Ziel der Wiedervereinigung – nie den Gedanken an eine eigene Heimat aufgegeben hat. Besonders in den Jahren von 2014 bis 2021 hat es laut Driedger einen bedeutenden Zeitgeistwechsel in der Ukraine gegeben. Indem Putin dies ignorierte, zeigte sich in den Tagen unmittelbar nach dem Einmarsch, wie sehr er sich verkalkuliert hatte. Seine Truppen trafen auf heftigsten Widerstand und mussten um ersten Mal schwere Verluste hinnehmen. Angriffskriege gegen ein motiviertes Volk sind schwer zu führen und selten zu gewinnen.
Die Ukrainer sind trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit besser motiviert, verfügen zunehmend über das bessere und modernere Material und achten auf ein gut ausgebildetes und fähiges Unteroffizierskorps. Bei all dem hapert es bei den Russen. „Der Kampfeswille in Russland ist gering“, stellte Driedger fest, der selbst einige Zeit wissenschaftlich in Moskau gearbeitet hatte. Während die jüngere Stadtbevölkerung sich an einen westlichen Lebensstil gewöhnt hat, besitzt Putin in der Weite der Fläche seines Landes einen starken Rückhalt: Er hat für Ordnung gesorgt und die Renten gesichert. Aber er selbst lebt in dem Dilemma, dass nahe Verwandte und Freunde westlich orientiert sind.
Was können wir in Deutschland in dieser Situation tun? Die Fragen der Forumsgäste, moderiert von Prof. Bernd Steffensen von der Hochschule Darmstadt, waren durchzogen von dem Gedanken, es müsse doch auch andere Wege zum Frieden geben. Etwa der Slogan „Frieden schaffen ohne Waffen“. Es gebe nur den Weg, so der Kern der Antwort, Misstrauen abzubauen. Im jetzigen Moment eine extrem langfristige Perspektive. „Beide Seiten wollen Frieden, aber nur zu ihren Bedingungen“, beschrieb Driedger die Falle, in der die Parteien sitzen.
Wir selbst sollten „uns nicht der Hoffnung hingeben, dass es bald mit diesem Krieg vorbei sein wird.“ Komme es zu einem „negativen Frieden“, so werde der Hass bleiben. Und auf die Idee angesprochen, dass der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder wegen seiner Freundschaft mit Putin etwas bewirken könne, meinte Driedger: „Man muss nicht denken: Wir schicken jemanden in den Kreml, und der wird dann schon etwas erreichen.“ So einfach seien die Gräben nicht zuzuschütten. Der Friedensforscher gab auch zu bedenken, dass Russland trotz der geopolitischen Machtdiskussion in den zwei Jahren seines Eroberungskrieges weltweit nicht an Sympathien hinzugewonnen habe. Lehnten bei Kriegsbeginn 2022 in der UNO 100 Staaten den russischen Angriffskrieg ab, so waren es jüngst bei einer Abstimmung 141. WV
China – der lachende Dritte?
Vom Player am Spielfeldrand zur Weltmacht
Mit den Referenten: Prof. Dr. Jörn Gottwald und Prof. Dr. Dirk Schmidt
Donnerstag, den 16. März 2023, 19.00 Uhr
Schloss Heiligenberg – Gartensalon
Auf dem Heiligenberg 8, 64342 Seeheim-Jugenheim

Die Drohungen gegen Taiwan, die Positionierung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Niederschlagung der Demokratiebewegung in Honkong, die Verletzung der Menschenrechte, der Umgang mit der Pandemie sowie die Machtkonzentration nach dem 20. Parteitag zeigen das machtpolitische Selbstverständnis Chinas von der Überlegenheit des eigenen Systems gegenüber dem Westen. Untermauert wird dies durch die rasante eigene wirtschaftliche, technologische und militärische Entwicklung und verwirklicht durch wirtschaftliche, infrastrukturelle Abkommen, wie sie sich etwa im Projekt „Seidenstraße“ zeigen.
Vom Spielfeldrand der Weltpolitik, mit dem Bestreben der Integration in das liberale internationale System, tritt China nun zunehmend mit den Ambitionen auf, die eigene Bedeutung in der Weltpolitik zu stärken und die Architektur des internationalen Systems zu verändern. Damit spitzen sich die Auseinandersetzungen zwischen den USA und China zu. Auch die EU und Deutschland stehen vor großen Herausforderungen und müssen sich neu positionieren.
Prof. Dr. Jörn Gottwald
Lehrstuhl für Politik Ostasiens an der Ruhr-Universität Bochum
Die chinesische Binnen- und Außenwirtschaft, Chinas Projekt „Seidenstraße“, die Strategie der Konnektivitätspolitik, Chinas Position in der Weltwirtschaft, wirtschaftliche Auswirkungen auf die EU, Auswirkungen des 20. Parteitags.
Prof. Dr. Dirk Schmidt
Lehrstuhl für Politik und Wirtschaft Chinas Universität Trier,
Senior Policy Fellow am Mercartor Institut for China Studies Berlin
Die chinesische Außen- und Sicherheitspolitik, Positionierung in der geopolitischen Auseinandersetzung: die Bedrohung Taiwans und der ostasiatische Raum, der russische Krieg gegen die Ukraine und das Verhältnis zu Russland, militärische und machtpolitische Konsequenzen.
Das Verhältnis China-USA-EU/Deutschland steht in der Diskussion: Von der Hoffnung auf eine wirtschaftlich gute Zusammenarbeit und eine auf Ausgleich zielende Politik bis zur neuen Realität der Konfrontation und Auseinandersetzung um die Architektur und Werte des internationalen Systems.
Moderation:
Stefan Schröder, Vorsitzender des Presseclubs Wiesbaden (PCW), ehemals Chefredakteur beim VRM
Mitschnitt der Veranstaltung:
Pressetext:
China-Experten im Forum Heiligenberg:
Mehr Intransparenz und obskure Putin-Freundschaft.
Seeheim-Jugenheim. 17. März 2023. „Wir haben es jetzt mit einem anderen China zu tun.“ Das richtige Timing bei der Themenwahl fliegt dem Forum Heiligenberg offenkundig nicht zum ersten Mal direkt in den Schoß: Mit frischen Analysen der kurz zuvor erfolgten Wahl des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jiangping auf Lebenszeit sorgten am Donnerstag, 16. März, die Wirtschafts- und Politikexperten Chinas von der Ruhr-Universität Bochum, Prof. Jörn Gottwald und der Mercator Stiftung, Prof Dirk Schmidt, Trier, für ein volles Haus im Jugenheimer Schloss.
Das „andere“ China sei seit Xis Griff zur höchsten Macht in den letzten Jahren intransparenter und unberechenbarer geworden. Der unter Deng Xiaoping ab 1978 vorangetriebene Reform- und Öffnungsprozess hat das Land nicht nur aus der Armut, sondern zu weit verbreitetem Wohlstand geführt. Begleitet war der Prozess von einer großen Wissbegier aller Bereiche von Partei, Wirtschaft und Institutionen nach den bestmöglichen Lösungen, gemäß dem Satz Dengs „Die Praxis ist das einzige Mittel, die Wahrheit herauszufinden“, das der Moderator Stefan Schröder vom Presseclub Wiesbaden zitierte.
Diese erfolgreichen Methoden der zurückliegenden Jahre hätten allerdings, so Prof. Schmidt, nun kein abruptes Ende. Man könne von wirtschaftlichen Reformen ausgehen und auch einer Privatisierung der Staatsbetriebe. Allerdings müsse man zukünftig mit einer straff organisierten marxistisch-leninistischen Kaderpartei rechnen, deren Kontrolle umfassend sei. Da alle Entscheidungen und politischen Programme nunmehr in einer Hand liegen und keine Person zum Ersatz oder der Nachfolge bestimmt ist, bestehe, so die Experten, ein hohes Risiko bei allen plötzlich ausbrechenden Krisen. Herde dafür gebe es genug: Manches geschehe unvermittelt, wie die Kehrtwende bei der Corona Politik. Das könne auch mit Taiwan passieren.
Sorgen bereitet den beiden Experten die gleiche geopolitische Sichtweise von Xi und Putin. Man dürfe die Freundschaft von Putin und Xi nicht unterschätzen, die sich in den letzten 20 Jahren 39-mal persönlich getroffen hätten. Ähnlich dem russischen Autokraten hätte auch Xi nostalgische Vorstellungen von einstiger Größe. Das ist so, „… als ob wir das Heilige Römische Reich wieder installieren wollten.“ Das Militär werde ausgebaut; inwieweit es aber risiko- und opferbereit sei, das lasse sich schwer einschätzen. Ob Russland und China eine echte Partnerschaft betreiben, sei fraglich. Beide Länder betrachten sich mit ewigem Misstrauen.
Der deutschen Wirtschaft empfahl Prof. Gottwald eine weniger blauäugige Sicht auf China. „Wir reden hier nicht mehr über einen Markt der Zukunft. China ist ein wichtiger Markt, aber auch ein hochkomplexer Markt.“ Das Wachstum sei niedriger als geplant, die Arbeitslosigkeit besonders in der Jugend hoch. Die Volksrepublik strebe eine starke Unternehmerelite an und versuche Weltkonzerne zu etablieren. Damit tue man sich aber schwer. Es wurde vielfach experimentiert. Privates Unternehmertum solle auch jetzt unter Xi wieder forciert werden.
Erstaunlich und bemerkenswert sei es, so Prof. Gottwald, dass eine vor über 100 Jahren gegründete kommunistische Partei einen festen Platz im Leben des Landes habe. „Der stillschweigende Vertrag zwischen Volk und Partei gilt bis heute.“ Die KP China hat Macht und Kontrolle und sorgt im Gegenzug für Aufstieg und Wohlstand. Mit einem Sozialismus à la DDR sei der chinesische Kommunismus nicht vergleichbar. Bewundernswert sei die überall vertretene Bereitschaft, auszuprobieren und zu lernen.
Zur anregenden und zielgerichteten Diskussion des Themas, ob Chinas Aufstieg vom „Player am Spielfeldrand zur Weltmacht“ dauerhaft erfolgreich bleiben könne, haben erneut die sehr gut ausgearbeiteten Fragen von Schülern des Schuldorf Bergstraße beigetragen. Verdrossenheit gegenüber politischen Gegenwartsfragen? Nicht bei solchen jungen Leuten. WV